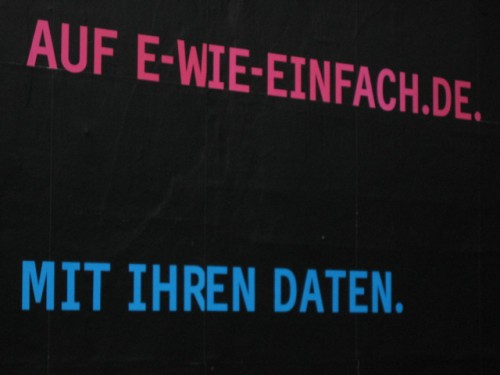Umsonst & draußen ist ein Fototagebuch, das wie das gleichnamige Buch Anfang 2006 beginnt. Das Material stammt größtenteils aus dem Blog november07, den Detlef Kuhlbrodt ab Ende 2006 und bis Herbst 2013 für die taz gemacht und für das Logbuch noch einmal durchgesehen, an einigen Stellen gekürzt und an anderen erweitert hat, um das Erzählerische zu betonen. Eigentlich ist Umsonst & draußen eher Fotogeschichte als Tagebuch; die Aufnahmen sind die Umgebung einer nicht erzählten Geschichte. Kuhlbrodt ist losgegangen auf der Suche nach Bildern, die irgendwie zueinanderpassen und dem Tag ein Gesicht geben. Manchmal sind die Helden Fahrräder, manchmal Autos, manchmal gibt es auch Menschen.
Freitag, 02.11.07
Ein paar Tage war ich mit dem kanadischen Filmemacher Darryl Miller herumgelaufen. Sein experimenteller Dokumentarfilm Dark One hatte mich sehr beeindruckt. Ein schwieriger psychedelischer Film auf der Höhe der Technik. Es geht um den heroinsüchtigen Dichter Dan Bilohar, der mit seiner Mutter, die in Auschwitz inhaftiert gewesen war, zusammenlebt; um die Realitätsschocks zwischen Drogenbildern, Halluzinationen und der Geschichte der Mutter. Die Perspektive des Films, ist extrem schwankend; infiziert von Millers eigener Drogengeschichte; anstrengend, traurig, radikalpsychedelisch, nur manchmal ein bisschen Galgenhumor; wenn ein kleiner Vogel, völlig enervierend im Grunde genommen, am Rande immer kleine Blechschalen vom Küchenschrank herunterschubst; ein enervierendes Scheppern in Schwarz-Weiß; für einen kleinen Moment wieder Klarheit. Der drogensüchtige Künstler, der als Jugendlicher begann, Burroughs nachzueifern, liebt diesen Vogel, ist ganz zärtlich zu ihm und erzählt dann, ganz knapp, als dieser Vogel stirbt, dies wäre schon der fünfte oder siebte tote Vogel in wenigen Jahren.
Ein Film, an dem sich die Geister schieden sozusagen. (Hier ist der Film.)
Ein Abgesandter von den »Human Rights Documentary Days« aus Kiew, ein sehr seelenvoll wirkender Mann, der mich an einen russischen Mystiker erinnerte; der jedenfalls kaum Englisch sprach und zugleich scheu und neugierig schien, fühlte sich von Dark One auch direkt angesprochen.
Der Film war so ein existenzielles Ding. Natürlich hatte Miller viel zu lange, acht Jahre, an dem Film gearbeitet.
Darryl Miller war zum ersten Mal in Europa und hatte eine schwere Reise hinter sich. Die Woche zuvor war er auf einem Filmfestival in Tschechien gewesen und ausgeraubt worden. Zum Glück hatte er nicht soviel Geld dabei gehabt.
Tagsüber rannte er durch Leipzig und drehte. Häuser, die danach verlangten gedreht zu werden, die vielen Polizisten, die am 31. wegen des Fußballs in der Stadt waren; Leute auf der Straße oder in der Tram. Er war ziemlich nervös; am Rande der Paranoia; so viele Leute, deren Sprache er nicht sprach; er kommt ja aus einer Stadt mit 600 Einwohnern und dies hier war dann manchmal doch too much.
Samstag, 03.11.07
Die Gäste warteten darauf, abgeholt zu werden.
Ein Mitarbeiter wies den Weg zur Abschlussparty zum Sonderzug der Straßenbahn Richtung Connewitz.
Die Abschlussparty war ein Geschenk; nicht nur für die Gäste und Teilnehmer, sondern auch für die anderen Filmfreunde, die zwar sechs Euro zahlen mussten, dafür aber auch Freigetränke und Schnittchen bekamen.
Dies Egalitäre beim Abschlussfest begeisterte mich wieder. Das hat auch mit dem Genre des Dokumentarfilms zu tun. Der Dokumentarfilm kennt ja eigentlich keine Stars; die Namen der großen Regie-Legenden des Genres sagen auch den meisten wenig; die Helden der Filme sind oft einfache Leute, die schwierige Situationen zu meistern haben; Gescheiterte, Verhinderte, kleine Helden. Sowohl die Poeten unter den Dokumentaristen, als auch die politischen Kämpfer oder die, die wie Hartmut Bitomsky gesellschaftliche Strukturen in einer ausufernden Untersuchung über Staub (so hieß sein Film) untersuchen, machen bei allen Unterschieden Filme für ein kleines, wenn auch oft hochgebildetes Publikum. (Figuren wie Michael Moore sind die absolute Ausnahme.)
Es wurde dann später beim Trinken und Reden. Lustig, dass auch die Männchenfilmerin Dagie Brundert da war. Wir beschlossen unseren Ché Guevara-Animationsfilm von 1994 im nächsten Jahr irgendwo einzureichen, zu zeigen, bzw. zum Verkauf anzubieten, weil nächstes Jahr ja auch ständig 1968 sein wird und unser Film zeigt ganz anschaulich, wie ein Volk seine Bedrücker besiegen und die Freiheit erringen kann.
Um kurz vor drei fuhren wir wieder heim.
Und in der Nacht war ich ganz aufgewühlt von den Tagen in Leipzig, dem Übermaß an Informationen, die ständig auf einen einprasselten, den vielen Menschen, den eigenen Erinnerungen an die vielen Leipzig-Besuche seit ’89, dass ich, obgleich ich bei der Abschlussveranstaltung viel getrunken hatte und erst um drei zurück ins Hotel gekommen war, kaum schlafen konnte.
Sonntag, 04.11.07
Alles schwirrte im Kopf herum; gleichzeitig durcheinander und völlig klar. Bilder, Momente, Gespräche und dazwischen ein Satz, der ungefähr lautete: »Das Dok-Festival ist mein Freund«, oder: »Wie schön, so einen netten Freund zu haben«. Dann schüttelt man im Halbschlaf ein wenig den Kopf über sich selbst.
Das klingt vielleicht als dürfe man, weil man mit dem Festival befreundet ist, nicht darüber schreiben, weil man ja voreingenommen wäre usw. Es ist aber anders, mit einem Festival – einem System aus Menschen, Veranstaltungen, Orten – befreundet zu sein, als mit einem Einzelmenschen. Über die Sachen befreundeter Künstler zu schreiben, hatte ich oft vermieden, weil ich’s emotional zu kompliziert fand (wenn ich’s dann doch tat, wurde der Text oft so verkrampft). Ein Festival ist aber eine Vielheit; mit den Jahren lernt man, wie’s funktioniert, kann Dinge besser einschätzen; lernt, dass sich Dinge immer nur langsam verändern, dass bestimmte Dinge, die meinetwegen 1998 richtig waren, es jetzt nicht mehr unbedingt sind usw.
Im Kopf ist alles klar; beim Schreiben über das Festival ist man trotzdem immer total gestresst; weil man in dem Moment, in dem man dann in Leipzig, im Stimmengewirr und Geklapper der Samstagabend-Menschen im Café Telegraph, anfängt zu schreiben, ja notwendigerweise schon außerhalb des Festivals ist, im Abschiedsschmerz allein sozusagen, zum Beispiel.
Montag, 05.11.07
Dienstag, 06.11.07
Jeden Tag.
Mittwoch, 07.11.07
Als wir die Sachen aus dem Haus trugen, überlegte ich immer noch, ob ich das Sofa nicht doch behalten sollte. Als letztes Möbelstück stand das Sofa in der alten Wohnung, die leer stand, seitdem ich sie vor zwei Monaten verlassen hatte, aber zunächst war es ja darum gegangen, den Umzug von A. zu vollenden, dessen Sachen immer noch – teils im Keller, teils im Hausflur herumstanden, während er schon längst bei seiner Freundin wohnte, deren Umzug auch anstand.
S., die Künstlerin, hatte wie immer beim Umziehen ihren roten Overall angezogen, in dem sie so entschieden entschlossen, also auch ein wenig selbstironisch aussah; in seiner dunklen Lederjacke wirkte H. so kreuzbergisch, wie auch sonst hinterm Tresen; A. trug ein 70er-Jahr-Jackett und manchmal nahm er seine Brille ab, weil ihn der Schweiss in seinem Gesicht behinderte.
Aber eigentlich geht es um das Sofa, Modell Colombo, das sich ganz allein in dem kleinen Zimmer der alten Wohnung langweilte. Während wir Bücher (v.a. Militärgeschichtschliches), Platten (v.a. Bob Dylan), Trödelmöbel, Mao-Poster, historische Musikanlagen und blaue Beutel mit Klamotten weg- und hintrugen, dachte ich an das Sofa.
Es war sozusagen Geist und Materie, ein floral motivierter Zweisitzer zum Ausziehen, den ich mir vor 13 Jahren in der irrsinnigen Hoffnung gekauft hatte, als Sofabesitzer in einem schönen Leben landen zu können. Doch schön war wie immer nur die Hoffnung darauf gewesen, diese Wochen im Frühling ’91 als sich der Wunsch aufs imaginäre Sofa geworfen hatte, als man meinte, den Mangel entdeckt zu haben, der das Dasein bislang mißlingen ließ, Wunsch und Mangel zusammenschweißte und wochenlang alle Berliner Möbelhäuser auf der Suche nach einem praktisch sachlichen Ausziehsofa abklapperte. Ermüdet vom Suchen und wohl auch aus Solidarität mit dem Osten, hatte ich damals das Modell Colombo gekauft. Das teuerste Möbel, dass ich mir je gekauft hatte. Modell Colombo wurde in den Farben von ’91 bezogen - Violett, Veilchenfarben und Pink – und kam dann auch nach ein paar Wochen. Damals war ich schon völlig entsetzt gewesen, als die Möbelpacker es in meinem Zimmer abgestellt hatten.
Zwei Jahre hatte ich darauf geschlafen. Meine Freundin hatte nur noch ungern bei mir übernachtet. Meist hatten unterschiedlich bescheuerte Decken seine violetten Blößen bedeckt. Irgendwie saß man darauf auch unbequem und dann hatte es eher ein Schattendasein geführt; manchmal auch auf dem Boden gestanden, die letzten Wochen meine frierende Ex-Wohnung bewacht und als wir nun in die kalte alte Wohnung gingen, tat es mir leid, wie es so da stand; ein komisch aussehender Freund vergangener Tage. Soviele Menschen hatten doch darauf auch gesessen und es kam mir brutal vor, wie wir es nun die Treppen runterschleiften, anstatt es behutsam zu tragen, es ins Auto reinquetschten, um es wegzufahren und die Vergangenheit, die ich bezahlt hatte, zu verraten und zu vernichten.
Die Vorstellung, es wirklich wegzuschmeissen, gefiel mir nicht. Den Trödlern gefiel das Sofa nicht; die Lager seien gefüllt – selbst bei der MOZ, in deren letzter Ausgabe eine so schöne Geschichte gestanden hätte, wie mir K. erzählt hatte, an diesem Abend, als sie wieder mit dem Kiffen aufgehört hatte; wie jedes Jahr, bis Himmelfahrt und auch kein Kaffee und kein Alkohol.
Es war zwar kalt, doch die Sonne schien, als wir Richtung Tempelhof zur Müllentsorgungsstelle der BSR fuhren. H. suchte im Radio nach dem „Rock-Sender“. Freunde von ihm, die in einer Band spielten, sollten da heute interviewt werden. Mir wurde ganz sentimental, als wir auf den Müllentsorgungshof fuhren. Ein lachender Müllwerker mit Bürstenhaarschnitt erklärte die unterschiedlichen Container, in die man seine Sachen tun sollte. Das meiste und das Sofa sollte in die Sieben. Die Sieben war ein großer orangener Container mit angeschlossener Zermalmungsmaschine. Der Müllwerker sagte stolz, das ginge alles ganz schnelle. Wir stiegen mit dem Sofa auf eine Empore und kippten es in den Container. Ich fotografierte es zum Abschied. Lachend hielt der Müllwerker die Maschine an und schaltete in den Rückwärtsgang. Damit ich den Grad der Verwüstung, Zerreissung, Zerhackung, den die alleszermahlende Maschine in meinem Sofa schon jetzt angerichtet hatte, besser fotografieren konnte. Alljährlich frass der Kronos seine Kinder, nur eins entkam ihm und die Rache war schrecklich. Noch einmal ein kurzer Abschiedsblick, auf die Innereien meines Ex-Sofas, die mich hilflos ungeordnet zerfetzt anschauten, dann wieder Vorwärtsgang.
Nach zwei drei Minuten war alle und erst später das erinnernde Entsetzen. Aber es war doch auch wieder ein lehrreich anschauliches Beispiel der Überlegenheit der Maschine über den Menschen, der Stunden und auch mehr Treibstoff wohl bräuchte, seine Sofas mit Händen, Füßen und Zähnen zu zerkleinern.
Auf der Rückfahrt hieß der Rocksender „STAR FM“. H.’s Freunde waren mit den „Ärzten“ befreundet und sagten was im Radio. Sie machten einen lustig lebendigen Eindruck. Alles lief ganz enstpannt ab. H. war stolz auf seine Freunde. „Soweit, bis in’s Radio, hat’s noch keiner von uns gebracht.“
Fühlte mich ganz dumm im Kopf; immer fiel mir nur ein, wie bei einem Weihnachtsgeschenk, »für … «, »von… « zu schreiben. Aber eigentlich ist das ja genau richtig und entspricht meinen Intentionen.
Später schaute auch noch Rainald Goetz vorbei. Ich freute mich sehr.
Donnerstag, 08.11.07
In der Baerwaldstraße vor anderthalb Jahren, als ich besonders traurig war; als hätte sie dort jemand extra für mich hingestellt.
Freitag, 09.11.07
Rainald Goetz hatte in seinem Blog über diesen Abend geschrieben. In etwa in der Länge, die die einzelnen Szenen in meinem Buch haben. Ich freute mich gleich darüber, wie er diesen schönen Abschluss eines schönen Abends beschrieben hatte und fand es interessant und lehrreich; das, was man gesehen hatte, ganz aufgeregt erlebt und in seinem Kopf auch ständig beschrieben hatte, durch die Schrift eines anderen noch einmal, nur ein bisschen anders zu sehen.
Wie schön es in der Wirklichkeit gewesen war, einander nach zwei oder drei Jahren wieder zu sehen. Und ermutigend, dass man, obwohl doch dazwischen soviel geschehen war, so schnell wieder selbstverständlich war, eine sehr geglückte soziale Situation, an diesem Abend im taz-Café. Eine weitere Spiegelung; Rainalds Text führte mir als Leser die Position vor, in der die Helden mancher Szenen vielleicht waren, wenn sie sie lasen. (nicht ganz, aber trotzdem)
Einige waren im Publikum, die für manche der Szenen Modell gestanden hatten. Freunde aus unterschiedlichen Lebensphasen, Kollegen, Leute, die sie selbst und zugleich diplomatische Vertreter (wie ich ja auch) der recht unterschiedlichen Gruppen waren, in deren Umfeld die Texte entstanden oder an die sich die Texte gerichtet hatten usw.
Christian, der DJ, hatte erzählt, dass es für die eine Szene auch Fotos gab, was ich nicht gewusst hatte.
Das war alles prima.
Die lustigste Begegnung mit Rainald war ein betrunkener Abschied in München gewesen, vor hundert Jahren, als er noch mit A. befreundet gewesen war; beim Weggehen hatte ich mich noch mal umgedreht und lachend gewinkt und als ich mich dann wieder zurückumgedrehte, war ich mit einer Laterne zusammengestoßen und hatte ganz viele Sterne gesehen.
Später hatten wir uns nur noch ab und an zufällig getroffen, in echt oder auch im Thinktank von Chance 2000; im Watergate vor zweieinhalb Jahren. Es waren immer gute Treffen gewesen mit anderen Freunden drumrum; in der Kommunikation war es immer auch um Kommunikation gegangen; um Realismus und solche Dinge.
Zigarettenrauchen. Dieser gesprächsverhindernde Reinheitsfetischismus. Das Rauchen ist ja nicht nur das Gift, sondern auch egalisierendes Kommunikationsmedium. Deshalb sind die kommenden Rauchverbote eine ziemliche Katastrophe für das Berliner Nachtleben, in dem fast jeder raucht und wahrscheinlich auch die, die dann später durch die Clubs rennen, um die Rauchverbote zu kontrollieren oder die Polizisten, die dann in ihren Wannen herbeifahren …
(Und dann werden wir alle dastehen und im Chor rufen: »Lasst die Zigarettenraucher frei … «)
Kurz hatte ich überlegt, ob ich das Buch nicht meinem Freund Mathias widmen sollte, der ja – so oder so leicht verschoben, verändert, verdeutlicht – nicht nur in vielen Szenen auftaucht, sondern auch in einigen anderen Texten das Modell abgibt für linke 70er-Jahre-Intellektuelle, die sich dann eine Weile wutentbrannt, entschlossen »verweigerten« und die mir natürlich näher stehen als die erfolgreichen Linken.
Marc Almond hätte ich das Buch auch fast gewidmet.
Dann war mir das aber zu affektiert vorgekommen und ich hatte es gelassen.
Und am Rande saß Helmut Höge und lächelte verschmitzt.
Samstag, 10.11.07
Seit Ewigkeiten kauf ich bei »Nah und Gut«. Herr Genc, der bis vor einigen Jahren noch hier gearbeitet hatte und nun in Rente ist (die anderen seiner Familienmitglieder führen das Geschäft weiter), hatte gelächelt und ich hatte zurückgelächelt und dann war es – selten länger als eine oder zwei Minuten – um Politik und wie’s einem geht gegangen. Und wenn es einem grad eigentlich schlecht gegangen war, hatte man es mit einer kleinen Geste und Augenbewegung nach oben nur angedeutet, sich ganz höflich voneinander verabschiedet und war dann wieder seiner Wege gegangen.
Der Nachmittag jetzt schaut schon ganz anders aus.
These Days

17:39
Mittenwalder Straße, Richtung Alex
Im »HAU 1«, gleich daneben, gab es die Premiere von Jörg Buttgereits Theaterstück Captain Berlin vs. Hitler. Das Stück war sehr lustig und prima.

22:56
Sonntag, 11.11.07
Am Abend guckten wir noch einmal meinen Lieblingsfilm; 00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter
Körschgen
Meine schöne Skulptur.
Montag, 12.11.07
Dann ging es los in ein neues Leben.
Er spielte tatsächlich Mercy Seat von Nick Cave zum Abschied.
Fahrt nach Marburg, zum Vorlesen.
Im Gästezimmer der Waggonhalle.
Ich war ziemlich aufgeregt. Zwar hatte ich auch früher schon einmal gelesen; beim taz-Kongress mit Michael Rutschky, in Linz, auf dem (Obdachlosen-)Kongress »Experten der Straße«, im Kreuzberger Antiquariat Kalligramm, bei Freunden zum Advent, aber bei diesen Veranstaltungen von früher hatte ich ja kein Buch dabei gehabt, dass die Leute kaufen konnten. Die Lesung im taz-Café letzte Woche war die erste mit Buch gewesen und jetzt in Marburg, in der Waggonhalle, eben die zweite.
In Hessen ist jetzt schon das Rauchen fast überall verboten. Deshalb stehen vor vielen Kneipen und Veranstaltungsorten Heizpilze, neben die man sich zum Rauchen stellt. Zur Zeit wird über ein Verbot der »Killerpilze« diskutiert. In Köln und Stuttgart zum Beispiel ist das schon geschehen. (Im Privaten mag jeder soviel verschwenden wie er mag; im öffentlichen Raum gilt das als obszön.)
Die Lesung war prima; die Leute, die da waren oder das organisiert hatten, waren total nett und angenehm; der Raum zum Lesen, das Licht und so, waren optimal. Ich fühlte mich sehr geehrt und las viel besser vor als in Berlin.
Nur dass die Lesung mit einem Foto von Harald Fricke beworben worden war, irritierte mich. Sie hätten meinen Namen bei Google eingegeben; da war halt auch das Foto gekommen, dass ich ’96 von Harald gemacht hatte. Seltsam, freundlich und elegant grüßte mich der Freund aus dem Jenseits.
© Alle Fotos: Detlef Kuhlbrodt